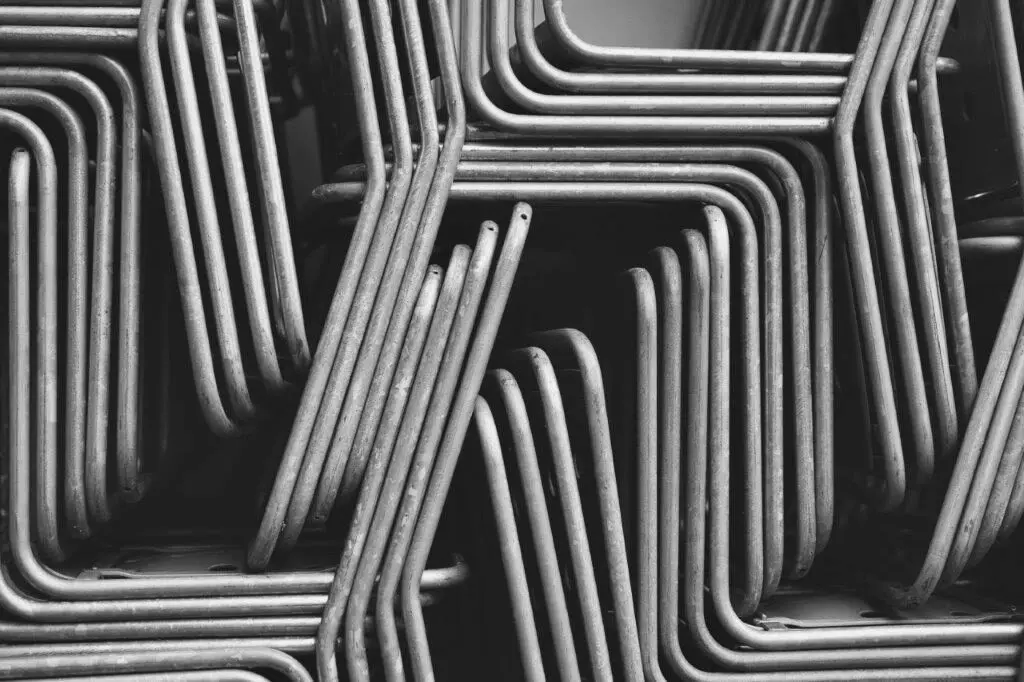Die kaufmännische Rügepflicht gemäß § 377 Handelsgesetzbuch (HGB) hat in der Bauwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese Pflicht gilt, wenn beide Parteien eines Kaufvertrages, z. B. über Baustoffe, Kaufleute im Sinne des HGB sind und ein erkennbarer Mangel vorliegt. In diesen Fällen ist der Käufer bei Wareneingang zur Prüfung und zur unverzüglichen Rüge verpflichtet. Geschieht dies nicht, entfällt die Haftung des Verkäufers für erkennbare Mängel, die nicht rechtzeitig beanstandet wurden.
Dies kann für Bauunternehmen erhebliche Auswirkungen haben, da die kaufmännischen Vorschriften des Kaufrechts seit der Schuldrechtsreform 2002 auch im Bauwesen vermehrt Anwendung finden. Dabei ist es durchaus schwierig zu beurteilen, ob auf ein Vertragsverhältnis Kaufrecht unmittelbar oder über Werklieferungsrecht Anwendung findet oder ein Werkvertrag vorliegt, im Rahmen dessen § 377 HGB keine Anwendung findet. Diese Fragen stellen sich meist dann, wenn Baustoffe geliefert und vom Lieferanten auch montiert werden müssen. In diesen Fällen stellt die Rechtsprechung auf den Schwerpunkt der Leistungspflichten ab, was ein weites Feld für die Kasuistik der Rechtsprechung eröffnet und von Einzelfall zu Einzelfall anders beurteilt werden kann.
Die Rügepflicht im Detail
§ 377 HGB unterscheidet zwischen offenen und versteckten Mängeln. Offene Mängel müssen unverzüglich nach Wareneingang und einer branchenüblichen Prüfung gerügt werden, versteckte Mängel hingegen unverzüglich nach deren Entdeckung. Ein Mangel gilt nicht nur dann als offen, wenn er für jedermann offensichtlich ist. Auch Mängel, die bei einer ordnungsgemäß durchgeführten Untersuchung festgestellt werden könnten, gelten als offene Mängel und sind daher sofort zu rügen.
Beispiel aus der Praxis
Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht die Anwendung der Rügepflicht am Bau: Eine Bau-GmbH erwirbt Stahl von einer Liefer-GmbH und vereinbart dabei einen maximalen Kohlenstoffgehalt des Stahls von 0,05 % sowie die Vorlage eines Werkszeugnisses zur Bestätigung dieser Stahlgüte. Bei Lieferung legt die Liefer-GmbH das verlangte Zeugnis vor. Erst nach sechs Monaten zeigt sich, dass der Kohlenstoffgehalt des gelieferten Stahls höher ist als vereinbart. Daraufhin rügt die Bau-GmbH den Mangel und verlangt Nachbesserung, doch die Ansprüche der Bau-GmbH werden abgelehnt. Das Gericht bestätigt die Entscheidung: Die Bau-GmbH hätte den Stahl sofort bei Lieferung untersuchen müssen, zumal eine Laborkontrolle branchenüblich, kostengünstig und zeitlich unaufwendig gewesen wäre und den Mangel sofort aufgezeigt hätte.
Rechtsprechung zur Rügepflicht
Die Rechtsprechung legt die Anforderungen an die Untersuchungspflicht des Käufers streng aus und fordert eine Interessenabwägung im Einzelfall. Eine reine Vorlage eines Werkszeugnisses entbindet den Käufer nicht von der Pflicht zur eigenen Prüfung der Ware. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat klargestellt, dass der Verkäufer davor geschützt werden soll auch lange nach der Ablieferung für schwer feststellbare Mängel einstehen zu müssen. Gerade bei Produkten, bei denen hohe Schäden drohen, steigen die Prüfpflichten des Käufers. Im konkreten Fall hat das OLG Hamm die Ansprüche der Bau-GmbH abgewiesen, da die Rüge nicht unverzüglich erfolgte (Urt. v. 25.06.2010, I-19 U 154/09).
Eine Entscheidung des Landgerichts (LG) Potsdam, das im Mai 2014 eine Probeentnahme zur Ermittlung der chemischen Zusammensetzung nicht für erforderlich hielt, zeigt, dass die Rügepflichten im Baurecht stark fallabhängig sind (Urt. v. 21.05.2014, 3 O 86/13).
Fazit und Empfehlung für die Praxis
Die kaufmännische Rügepflicht nach § 377 HGB hat für Bauunternehmen weitreichende Konsequenzen. Die Gerichte setzen bei offenen Mängeln eine zeitnahe und gründliche Untersuchung und eine unverzügliche Rüge von Mängeln voraus. Die Verletzung dieser Pflicht kann zu erheblichen Rechtsnachteilen führen, insbesondere zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen.
Bauunternehmen sollten daher besonderes Augenmerk auf die Produktprüfung legen und sich ihrer Untersuchungs- und Rügepflicht bewusst sein. Eine vertragliche Vereinbarung kann die Rügepflicht abbedingen oder abmildern. So könnte der Käufer etwa eine Garantie für die chemische Zusammensetzung des Produkts vereinbaren, wodurch § 377 HGB keine Anwendung fände.