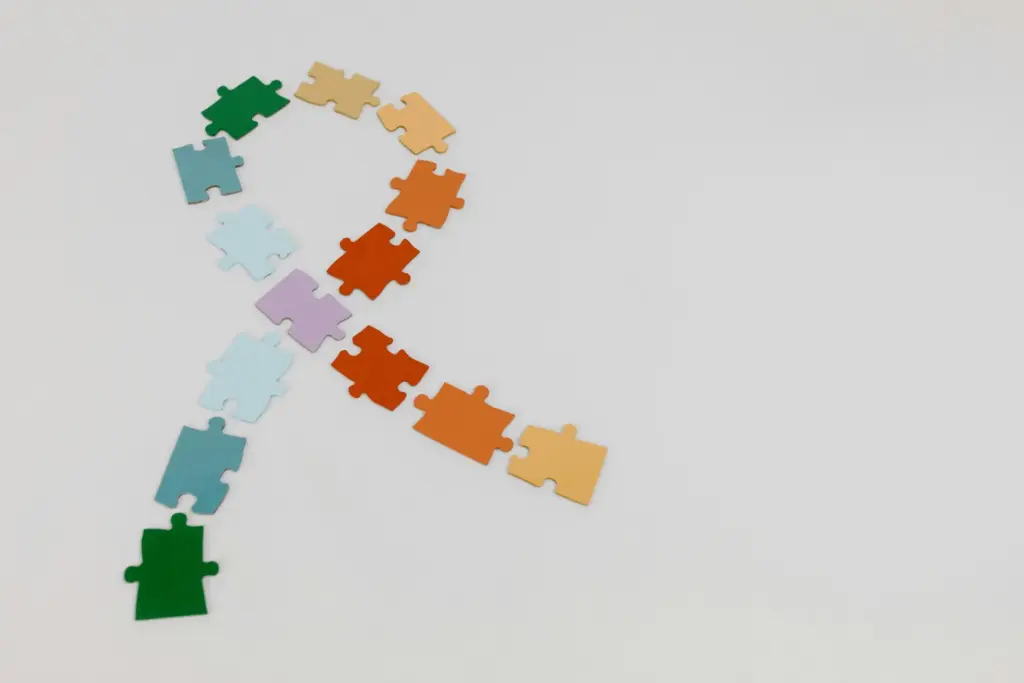Besonders beliebt gerade bei jungen Startup-Unternehmen, aber auch bei bereits „ausgewachsenen“ mittelständischen und Groß-Unternehmen sind insoweit Gestaltungformen, bei denen auf vertraglicher Grundlage virtuelle Optionen an Mitarbeiter gewährt werden (Virtual Stock Options). Diese vermitteln keinen Anspruch auf den Erwerb einer „realen“ gesellschaftsrechtlichen Beteiligung (etwa verbunden mit dem Recht auf Teilnahme an Haupt- und Gesellschafterversammlungen oder laufende Gewinne), sondern begründen einen Anspruch auf Zahlung gegen die Arbeitgeber-Gesellschaft für den Fall des Eintritts eines im Vertrag bzw. dem zugrunde liegenden Beteiligungsprogramm (sogenannter Virtual Stock Option Plan (VSOP)) definierten Exit-Ereignisses (z. B. Verkauf des Unternehmens oder Börsengang).
Das VSOP sieht dabei regelmäßig im Interesse einer langfristigen Bindung der Mitarbeiter vor, dass die Rechte aus zugeteilten virtuellen Optionen erst über eine sogenannte Vesting-Periode von häufig mehreren Jahren sukzessive erdient werden müssen, bevor sie geltend gemacht werden können und zudem eine Mindestwartezeit (sogenannte Cliff) einzuhalten ist. Zur weiteren Forcierung der Bindungswirkung der virtuellen Optionen sollen bereits gevestete, also erdiente und ausübbare, virtuelle Optionsrechte ersatzlos vollständig oder teilweise bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses entfallen, wobei typischerweise wegen der Folgen zwischen den Sachverhalten eines „Bad Leaver“ (z. B. Eigenkündigung des Arbeitnehmers oder verhaltensbedingte Kündigung durch den Arbeitgeber) und „Good Leaver“ (z. B. ordentliche Kündigung des Arbeitgebers) differenziert wird.
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) waren solche für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorgesehenen Verfallklauseln in VSOP rechtlich wirksam. Das BAG hatte noch im Jahre 2008 in einer bislang für die Praxis maßgeblichen Entscheidung angenommen, dass es sich bei bereits gevesteten Optionen, bei denen während des Arbeitsverhältnisses das Exit-Ereignis noch nicht eingetreten war, lediglich um reine Erwerbschancen mit spekulativem Charakter handele, die keinen gesicherten Vergütungsbestandteil darstellten.
Neue Rechtsauffassung des BAG
Von dieser Betrachtung hat sich das BAG ausdrücklich distanziert (Urt. v. 19.03.2025, 10 AZR 67/24 – noch nicht veröffentlicht). Dem lag folgende typische Konstellation zugrunde: Der Kläger war von 2018 bis 2020 bei dem beklagten Unternehmen beschäftigt und hat das Arbeitsverhältnis durch fristgerechte Eigenkündigung beendet. Bereits im Jahre 2019 hatte der Kläger auf der Grundlage des VSOP von der Beklagten virtuelle Optionsrechte erworben. Die dem Arbeitnehmer so zugeteilten virtuellen Optionen wurden nach Ablauf eines Cliff von 12 Monaten und über die Dauer einer insgesamt vier Jahren dauernden Vesting-Periode gestaffelt ausübbar. Das Vesting, also die Möglichkeit zur Erdienung der Ausübbarkeit der Ansprüche aus den Optionsrechten, war jeweils ausgesetzt, wenn der Arbeitnehmer von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung befreit war (z. B. Urlaubszeiten). Unter bestimmten Voraussetzungen („Bad Leaver“), u. a. im Falle der Eigenkündigung des Arbeitnehmers, sollten gevestete, jedoch noch nicht ausgeübte virtuelle Optionsrechte ersatzlos entfallen. In anderen Beendigungsfällen („Good Leaver“) sollten gevestete, jedoch noch nicht ausgeübte virtuelle Optionsrechte schrittweise im Rahmen eines sogenannten De-Vesting innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses verfallen. Zum Zeitpunkt der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses waren etwa 1/3 der dem Kläger zugeteilten Optionsrechte bereits gevestet. Der Kläger machte seine (zukünftigen) Rechte aus diesen virtuellen Optionen durch Feststellungsklage gegen den Arbeitgeber geltend, nachdem dieser die Berechtigung des Klägers mit Verweis auf den Verfall der Optionsrechte nach dem VSOP zurückgewiesen hatte.
Nachdem die Vorinstanzen noch die Klage unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BAG aus dem Jahre 2008 zurückgewiesen hatten, begründete das BAG seine nun abweichende Auffassung im Ausgangspunkt damit, dass es sich bei dem VSOP um Allgemeine Geschäftsbedingungen handele, die einer Inhaltskontrolle nicht Stand hielten, da sie eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers darstellten. Bereits gevestete, also verdiente, Optionsrechte stellten eine Gegenleistung für bereits erbrachte Arbeitsleistungen des Klägers dar. Hiervon abweichende Bestimmungen in den VSOP widersprächen dem gesetzlichen Leitbild, wonach ein Arbeitgeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung für erbrachte Arbeitsleistungen verpflichtet ist (§ 611a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)). Hinzu kam aus Sicht des BAG, dass die Verfallklausel für den Fall der Eigenkündigung eine unverhältnismäßige Kündigungserschwerung zu Lasten des Arbeitnehmers darstelle. Auch die Regeln zum sogenannten De‑Vesting hielten der Überprüfung des BAG jedenfalls im Hinblick auf den vorliegenden Sachverhalt nicht stand. Zwar könne das beklagte Unternehmen zur Begründung für diese Regelung anführen, dass der Arbeitnehmer nach seinem Ausscheiden keinen weiteren Einfluss mehr auf die Entwicklung des Unternehmenswertes durch eigene Tätigkeit habe. Allerdings verfielen im zu entscheidenden Fall die gevesteten Optionen doppelt so schnell, wie sie hätten erdient werden können. Dies führe im Ergebnis dazu, dass die Zeit unberücksichtigt bliebe, die der Arbeitnehmer durch Erbringung seiner Arbeitsleistung in der Vesting-Periode für die ausübbaren Optionsrechte aufgewandt habe. Besondere Interessen des Arbeitgebers, die für die kürzere Verfallfrist hätten angeführt werden können, sah das BAG als nicht gegeben an.
Konsequenzen für die Praxis
Für die Praxis ergeben sich aus den bislang vorliegenden Informationen zur Entscheidung des BAG, vorbehaltlich einer Auswertung der vollständigen Urteilsgründe, die für die kommenden Monate zur Veröffentlichung angekündigt sind, folgende Auswirkungen:
- Es wird davon auszugehen sein, dass ein Total-Verfall von gevesteten virtuellen Optionen jedenfalls für den Fall einer Eigenkündigung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zulässigerweise möglich ist. Unternehmen, die entsprechende VSOP in der Vergangenheit aufgelegt haben, werden ihre Bedingungswerke daraufhin zu überprüfen haben, Anpassungsbedarfe einordnen müssen und gegebenenfalls im Hinblick auf konkret anstehende Exit-Ereignisse etwaige dadurch entstehende Ansprüche ehemaliger Mitarbeiter aus gevesteten Optionen zu bewerten und zu berücksichtigen haben.
- Anpassungen der VSOP im Lichte der Rechtsprechung des BAG können zum einen darauf ausgerichtet sein, die vom Gericht angenommene Entgeltfunktion der virtuellen Optionen durch vertragliche Gestaltung auszuschließen (z. B. durch ein Vesting auch während solcher Zeiten, in denen eine Pflicht zur Arbeitsleistung nicht besteht). Zum anderen könnten die Auswirkungen gedämpft und gleichzeitig eine Incentivierung für eine längerfristige Beschäftigung erreicht werden, indem ein exponentielles bzw. dynamisches Vesting während der Vesting-Periode eingeführt wird. Hierbei würde der Anteil der jeweils gevesteten virtuellen Optionen während der Vesting-Periode ansteigen (z. B. von 10 % im ersten Jahr der Vesting-Periode auf 20 %, 30 % und 40 % in den folgenden drei Jahren bei einem Vier-Jahres-Zeitraum) und nicht, wie wohl im Streitfall des BAG, linear verlaufen. Weitere Anpassungen, wie z. B. eine Verlängerung des Cliff als Mindestwartezeit, sind ebenfalls denkbar.
- Mit großem Interesse erwartet werden die Urteilsgründe des BAG auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen zur Frage der Zulässigkeit eines Verfalls von virtuellen Optionen bei weiteren Bad-Leaver-Konstellationen, insbesondere Kündigungen des Arbeitgebers wegen eines vom Mitarbeiter zu vertretenden wichtigen Grundes. An sich dürfte es auf der Linie der bislang bekannt gewordenen Auffassung des BAG liegen, dass wegen des Entgeltcharakters der gewährten virtuellen Optionen sogar im Falle berechtigter verhaltensbedingter Kündigungen ein Verfall als unwirksam anzusehen wäre.
Es bleibt also spannend.