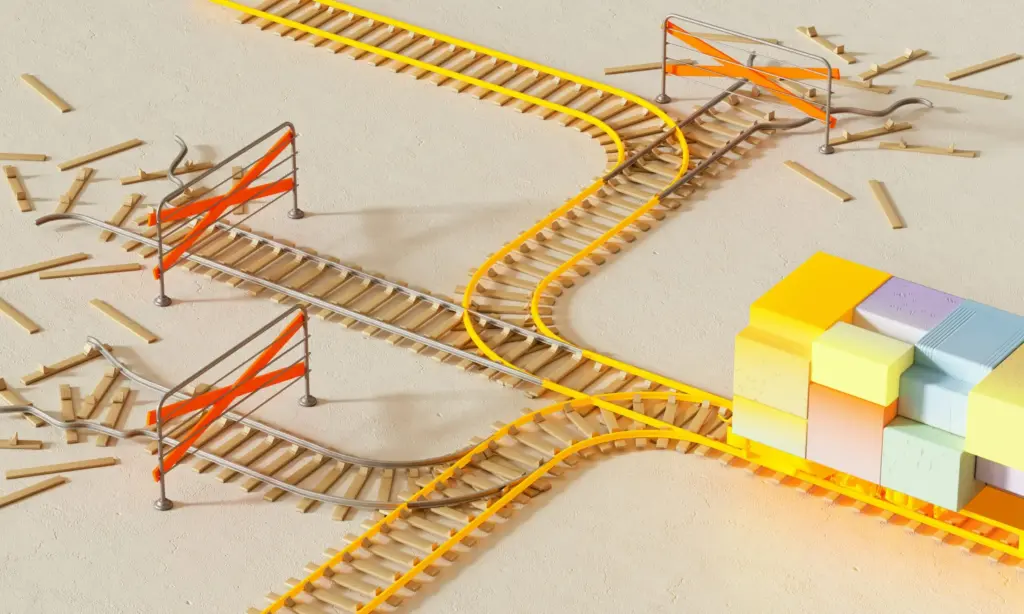Denn grundsätzlich bedarf es für die Geltendmachung von – der GmbH zustehenden – Schadensersatzansprüchen gegen den Geschäftsführer einer GmbH gemäß § 46 Nr. 8 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) eines zustimmenden Gesellschafterbeschlusses, der materielle Voraussetzung für die Geltendmachung des Anspruchs ist. Liegt der für die Geltendmachung der Schadensersatzansprüche erforderliche Gesellschafterbeschluss nicht vor, ist die hierauf gerichtete Klage als unbegründet abzuweisen.
In der Praxis unternimmt der Mehrheitsgesellschafter regelmäßig den Versuch, die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen dadurch zu torpedieren, dass er bei der Beschlussfassung gegen die Geltendmachung der Schadensersatzansprüche stimmt. In diesen Fällen bleibt das Abstimmungsergebnis im besten Fall offen, wenn der Versammlungsleiter eine Beschlussfeststellung unterlässt. Stellt er einen die Geltendmachung ablehnenden Beschluss fest, muss der Minderheitsgesellschafter gegen diesen mit einer Anfechtungsklage kombiniert mit einer Beschlussfeststellungsklage fristgebunden vorgehen.
In beiden Fällen war die Geltendmachung der Schadensersatzansprüche mit zusätzlichem Aufwand, jedenfalls aber mit einer Zeitverzögerung für den Minderheitsgesellschafter verbunden, sodass sich für diesen die Frage stellt, ob er die Ansprüche im eigenen Namen zugunsten der Gesellschaft (sogenannte „actio pro socio“) geltend machen kann.
Diese Frage hat der Bundesgerichtshof (BGH) (Urt. v. 05.11.2024, II ZR 85/23) verneint und dem Minderheitsgesellschafter einen effektiveren Weg der Geltendmachung im Namen der Gesellschaft bestätigt:
So bestätigt der BGH in seiner Entscheidung, dass es der Fassung eines Gesellschafterbeschlusses gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG immer dann nicht bedarf, wenn der andere Gesellschafter einem Stimmrechtsverbot gemäß § 47 Abs. 4 GmbHG unterliegt, weil er ansonsten „Richter in eigener Sache“ wäre. Dies ist nicht nur dann zu bejahen, wenn ein Anspruch gegen den Gesellschafter persönlich geltend gemacht werden soll, sondern auch dann, wenn dessen gesetzliche Vertreter betroffen sind.
Mit der Entscheidung hat der BGH nun klargestellt, dass es eines Gesellschafterbeschlusses zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Geschäftsführer dann nicht bedarf, wenn der andere Gesellschafter bei der Entscheidung einem Stimmverbot unterliegt. Dies ist nach Auffassung des BGH nicht nur dann zu bejahen, wenn Ersatzansprüche unmittelbar gegen den Mehrheitsgesellschafter als Geschäftsführer geltend gemacht werden sollen, sondern auch dann, wenn die Organe des Mehrheitsgesellschafters selbst über die Geltendmachung gegen sie gerichteter Ansprüche in der Beteiligungsgesellschaft abstimmen.
Vielmehr kann der Minderheitsgesellschafter unmittelbar als Prozessvertreter im Namen der Gesellschaft – oder durch Bestellung eines Vertreters – die Ansprüche auf Kosten der Gesellschaft geltend machen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass der Minderheitsgesellschafter wegen des Fehlens eines Stimmverbots des anderen Gesellschafters nicht berechtigt war im Namen der Gesellschaft zu klagen oder die Klage (auch aus anderen Gründen) unbegründet ist, riskiert der Minderheitsgesellschafter, sich seinerseits einem Regressanspruch der Gesellschaft ausgesetzt zu sehen.
Die Frage, ob im konkreten Einzelfall ein Stimmverbot des Mehrheitsgesellschafters besteht, sollte individuell geprüft werden, zumal der Mehrheitsgesellschafter berechtigt sein soll, zur Wahrung seines Stimmrechts einen unbefangenen Vertreter zu bestellen.