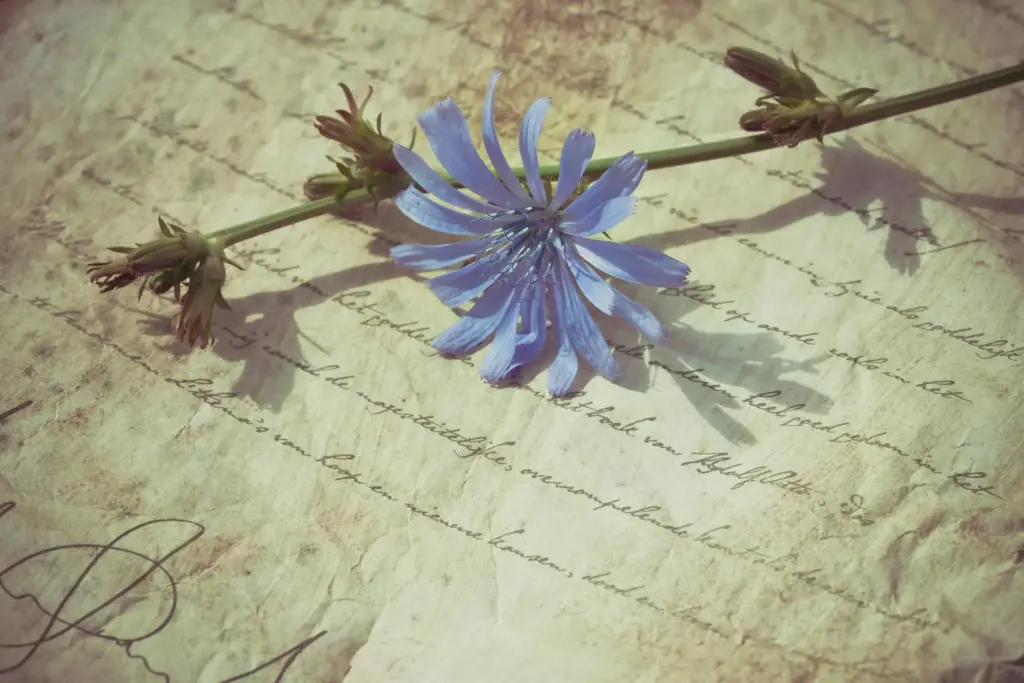Eine solche Bestimmung kann durch notariell beurkundeten Erbvertrag oder durch Testament geschehen. Ein Testament kann dabei entweder zur Niederschrift eines Notars oder durch eine vom Erblasser abgegebene Erklärung errichtet werden (privatschriftliches Testament). Ein solches privatschriftliches Testament ist formgültig, wenn es vom Erblasser eigenhändig (das bedeutet der gesamte Text muss selbst geschrieben werden) erstellt und unterschrieben wurde. Ferner soll das Testament eine Datums- und Ortsangabe enthalten.
Neben allerhand Problemen, die sich bereits aus der vorgeschriebenen Form ergeben können, weisen solche privatschriftlichen Testamente klassischerweise auch inhaltliche Schwächen auf, die ein notarielles Testament (bestenfalls) nicht enthält.
Der Fall
Mit einigen dieser „Klassiker“ musste sich unlängst das Oberlandesgericht (OLG) Hamm beschäftigen (E. v. 19.03.2025, I 10 W 40/25).
In dem zugrundeliegenden Fall war die am 22.04.1935 geborene und am 26.12.2023 im Alter von 88 Jahren verstorbene Erblasserin unverheiratet und kinderlos. Auch hatte sie keine Geschwister; ihre Eltern waren vorverstorben. Als letztwillige Verfügung hinterließ sie ein handschriftliches Testament vom 12.09.2014.
In dem Testament waren u. a. folgende Verfügungen getroffen:
- Meine Cousine Christa erbt mein Haus und Grundstück Ringstraße 83 sowie meine persönlichen Dinge, das gesamte Wohnungsinventar und mein Auto.
- Mein Haus und Grundstück Gartenstraße erbt Ursula, geb. am 20.07.1969, mit der Auflage, es nicht zu verkaufen, sondern es an eines ihrer Kinder zu vererben, weil es das Stammhaus der Familie ist. Außerdem erhält Ursula EUR 10.000.
- Meine Cousine Else erhält EUR 20.000.
- Anke soll EUR 20.000 erhalten.
- Die Skulptur „Europa“ soll in die JD Stiftung gegeben werden.
- Das Kapital, welches nach Abzug der Bestattungskosten (Sarg, Gebühren, Belegstelle, Grabschmuck und Grabplatte mit meinem Namen und Grabpflege für die gesamte Belegzeit) noch vorhanden ist, soll ebenfalls meine Cousine Christa erhalten.
Die Cousine Christa, die zwei Jahre jünger war als die Erblasserin, verstarb am 07.07.2023, also ein halbes Jahr vor der Erblasserin. Es stritten sich nunmehr die drei Kinder der Cousine Christa sowie Ursula darüber, wer und zu welchem Anteil Erbe der Erblasserin geworden ist.
Die Erbeinsetzung
Als ersten „Klassiker“ enthält das Testament keine eindeutige Erbeinsetzung. Wie § 1922 BGB bestimmt, geht die Erbschaft als Ganzes auf eine oder mehrere Personen (nach Bruchteilen) über. Das bedeutet, dass es (bis auf ganz wenige Ausnahmen) nicht möglich ist, bestimmte Gegenstände aus seinem Vermögen direkt einzelnen Personen im Erbfall dinglich zuzuweisen. § 2087 Abs. 2 BGB regelt sogar, dass die Zuwendung einzelner Gegenstände im Zweifel keine Erbeinsetzung darstellt.
Für das obige Testament bedeutet das, dass die Erblasserin zwar den Wunsch hatte, ihre jeweiligen Immobilien der Cousine Christa und Ursula zuzuweisen. Rechtlich sind nach dem Tod der Erblasserin aber erstmal der oder die Erben in die Rechtstellung der Erblasserin eingetreten und Eigentümer der Immobilien geworden. Die Erblasserin in unserem Fall hatte aber nicht bestimmt, dass Christa oder Ursula ihre Alleinerben oder ihre Erben nach Bruchteilen sein sollten.
In einem solchen unklaren oder womöglich widersprüchlichen Fall ist ein Testament auszulegen. Auslegung bedeutet, dass der wirkliche Wille des Erblassers bei Testamentserrichtung zu erforschen ist.
Das bei fast jeder Testamentsauslegung auftretende Problem liegt dabei auf der Hand: Der Erblasser lebt nicht mehr und kann keine Auskunft darüber erteilen, was er sich bei Testamentserrichtung gedacht und gewünscht hat.
Ausgangspunkt bei jeder Auslegung muss daher der Wortlaut des Testaments sein. Die Erblasserin hat im Zusammenhang mit Christa und Ursula zweimal das Wort „vererben“ benutzt. Das spricht vorliegend dafür, dass diese beiden Personen auch ihre Erben im Rechtssinne sein sollten. Für Christa kommt hinzu, dass die Erblasserin unter Ziffer 6 ihres Testaments verfügt hatte, dass Christa auch alle sonstigen persönlichen Gegenstände von der Erblasserin erhalten sollte. Sie sah Christa offensichtlich als ihre Rechtsnachfolgerin an.
Bei Else und Anke benutzte die Erblasserin hingegen das Wort „erhalten“ und bei der Stiftung die Wendung „soll gegeben werden“. Diese unterschiedliche Ausdrucksweise spricht wiederum dagegen, dass Else, Anke und die Stiftung auch Erben sein sollten
Im Ergebnis kam das OLG daher zu dem Schluss, dass die Erblasserin wollte, dass sie von Christa und Ursula beerbt wird.
Der fehlender Wille der Erblasserin
Allerdings hatte die Erblasserin noch einen weiteren „Klassiker“ in ihren letzten Willen eingebaut: Obwohl sie das Testament mit 79 Jahren verfasst hatte und darin ihre Cousine Christa, die bei Testamentserrichtung auch schon 77 Jahre alt war, eingesetzt hatte, hatte die Erblasserin nicht bestimmt, was passieren sollte, wenn Christa vor oder nach dem Eintritt des Erbfalls wegfällt.
Nun mag man einwenden, dass ein solches Verhalten im Alter von 77 bzw. 79 Jahren grob fahrlässig sein dürfte und dem ist auch nicht zu widersprechen. Das „Vergessen“ eines sogenannten Ersatzerben tritt aber auch dann regelmäßig auf, wenn Eltern ihre Kinder in Testamenten als Erben einsetzen aber nicht bedenken, dass diese beispielsweise durch Unfall oder Krankheit vor ihnen versterben könnten.
In dem vorgestellten Fall musste sich das OLG also auch mit der Frage beschäftigen, ob in der Erbeinsetzung von Christa stillschweigend auch verfügt war, dass im Falle ihres Vorversterbens deren Abkömmlinge an ihre Stelle treten und die Erblasserin beerben sollten.
Setzt jemand in einem Testament einen Abkömmling zu seinem Erben ein, bestimmt § 2069 BGB, dass im Zweifel genau das passieren soll – das heißt, dass bei Wegfall eines als Erben eingesetzten Kindes im Zweifel die eigenen Enkel an dessen Stelle treten und erben werden.
Die Vorschrift gilt ihrem Wortlaut nach aber ausdrücklich nur für Abkömmlinge und war im entsprechenden Fall daher nicht (auch nicht analog) anwendbar. Das Testament musste also wieder ausgelegt werden. Da die Kinder von Christa zu der Erblasserin ebenfalls ein gutes Verhältnis pflegten und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Erblasserin mit Christa eine Person aus ihrer väterlichen Linie und mit Ursula eine Person aus ihrer mütterlichen Linie mit ihren wesentlichen Vermögensgegenständen bedacht hatte, leitete das OLG ab, dass Christa nur repräsentativ für ihren Stamm stehen sollte. Außerdem unterstellte das OLG – wie bereits oben angesprochen –, dass man damit rechnen muss, dass ein Erbe wegfällt, wenn dieser bei Testamentserrichtung bereits 77 Jahre alt war und nur unwesentlich jünger als man selbst ist.
Das OLG stellte also abschließend fest, dass Erben nach der Erblasserin Ursula und die drei Kinder von Christa in Erbengemeinschaft sind.
Fazit
Der Sachverhalt und die Entscheidung zeigen auf, dass selbst bei relativ einfach strukturierten Nachlässen und auch dann, wenn der Erblasser genau weiß, was er eigentlich will, bei der handschriftlichen Errichtung von Testamenten Probleme auftreten können. Der rechtliche Laie kennt weder das Prinzip der Gesamtrechtsnachfolge noch die Fachtermina (Erbe, Vermächtnis, Auflage etc.), die seinen Vorstellungen und Wünschen entsprechen. Das führt regelmäßig zu Unklarheiten, die im Streitfall nur durch zeit- und kostenintensive Gerichtsverfahren ausgeräumt werden können.
Bei jeder Testamentserrichtung sollte daher stets ein rechtlicher Berater (Fachanwalt für Erbrecht oder Notar) hinzugezogen werden. Dabei entstehen zwar Kosten, die jedoch bei notwendigen Gerichtsverfahren weit überstiegen werden. Außerdem wirkt ein notarielles Testament im Rechtsverkehr weitestgehend wie ein Erbschein, der bei Vorhandensein lediglich eines handschriftlichen Testaments eigentlich stets beantragt werden muss und ebenfalls Kosten verursacht.
Drum merke im Erbrecht, dass falscher Geiz eben nicht geil ist, sondern im Erbrecht der Grundsatz gilt: Gute Beratung hat zwar ihren Preis, führt aber zum gewünschten Ergebnis.